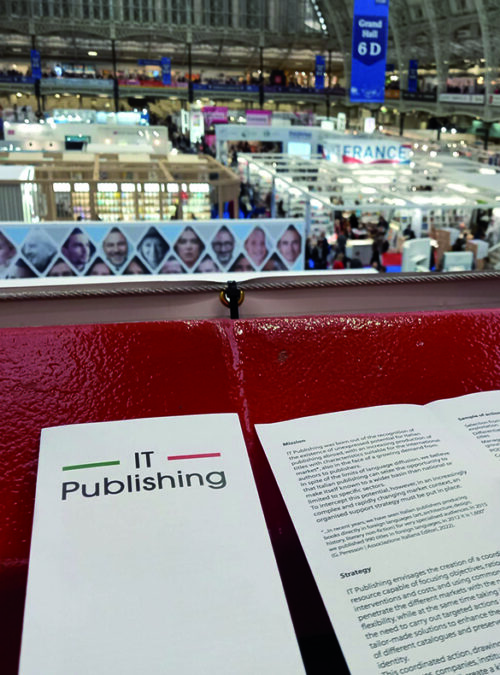Interview mit Matteo Codignola, Direktor von Orville Press
Autor: Laura Pugno
 © Max De Martino
© Max De Martino
In seiner Interviewreihe hat newitalianbooks beschlossen, den neuen Verlagsrealitäten der italienischen Szene eine Bühne zu bieten. In dieser Folge haben wir Matteo Codignola zu Gast, der nach vielen Jahren beim Adelphi-Verlag als Redakteur, Übersetzer und Artdirektor die Marke Orville Press gegründet hat. Wir stellen ihm daher die Frage: „Wie kann man den ausländischen Lesern von newitalianbooks das Verlagsprojekt von Orville Press und seine Identität näher bringen?“
Matteo Codignola
Wer die glänzende Idee hat, im Jahr 2023 einen Verlag oder eine Verlagsmarke zu eröffnen, muss auch damit rechnen, gefragt zu werden, ob er oder sie verrückt geworden ist oder schon vorher verrückt war. In meinem Fall war ich es schon vorher, so dass ich der Frage in gewisser Weise ausweichen darf. Ich mache schon länger Bücher, als ich bereit bin zuzugeben, allerdings musste ich mir bisher nie darüber Gedanken machen, wo die Bücher veröffentlicht werden – ich wusste wo. Aber es ist passiert, und ein paar Wochen lang war ich mir selbst nicht ganz sicher, welche Richtung ich einschlagen sollte. Das Verlagswesen ist mit hohen Kosten und geringen Einnahmen verbunden, und ich hatte weder ein Vermögen zu verschenken noch einen Freund, der leichtsinnig genug war, mir seines anzuvertrauen – wofür ich vollstes Verständnis habe. Die Situation war also nicht einfach und wäre wahrscheinlich noch komplizierter gewesen, wenn nicht plötzlich ein absolut unerwarteter weißer Ritter aufgetaucht wäre. Ich kenne Stefano Mauri schon lange, und es war oft der Fall, dass wir bei Unterhaltungen über unsere Berufe gesprochen haben. Als er hörte, was ich vorhatte, nämlich einen kleinen Verlag zu gründen, der jährlich etwa ein knappes Dutzend Titel veröffentlicht, deren Inhalt von angemessen bis anspruchsvoll sein und sich vor allem an der zeitgenössischen Literatur orientieren sollte, schlug Stefano sofort vor, dass ich das mit ihnen zusammen mache könnte. Das kam ehrlich gesagt sehr unerwartet. Mit ihnen – meinte er GeMS, die zweitgrößte Verlagsgruppe Italiens, was eine Reihe von Dingen mit sich brachte – von denen ich glaubte, die letzte sei der Wunsch, eine weitere Marke und noch dazu dieser Art hinzuzufügen, denn dort waren bereits eine nicht unerhebliche Anzahl ähnlicher präsent. Außerdem hatte ich drei Jahrzehnte, wenn nicht sogar mehr, unabhängiges Publizieren hinter mir, und es schien mir ein bisschen zu spät, um die Rolle zu wechseln. Aber in Wirklichkeit war die Aussicht, eine kleine Marke zu gründen, die als autonome Einheit innerhalb einer Verlagsmaschinerie agiert, die eher einer Industrie gleichkommt, unter verschiedenen Gesichtspunkten ein verlockendes Experiment – so konnte ich z.B. den recht erheiternden Abstand zwischen der Bedeutung, die Stefano dem Wort Marge zuschreibt, und der, die ich ihm zuschreibe, in der Praxis überprüfen. Ohne groß darüber nachzudenken, legten wir also los.
Die erste Schwierigkeit war, wie immer, einen Namen zu finden. Was mich betrifft, so gab es bereits einen, und zwar vom ersten Augenblick an: Orwell. Ich habe ihn natürlich aus Bewunderung für den Autor ausgewählt, aber auch aus zwei weniger solipsistischen Gründen. Der erste Grund war die Art von Büchern, die Orwell geschrieben hat: Texte, die sich stark voneinander unterscheiden, aber immer im außergewöhnlichen Einklang mit der Welt waren, die sie hervorgebracht hat – es sei denn, diese Welt hat sie nicht hervorgebracht, wie im Fall von Farm der Tiere und 1984. Aber es gab noch einen anderen, verborgenen Grund. Mit Ausnahme der Romane hatte Orwell immer Texte geschrieben, die weder einem Genre noch einem Regal zuzuordnen waren, und das zwang ihn, für fast jedes Buch die jeweils passendste Form zu finden. Das ist vielleicht eine der Erkenntnisse, die diejenigen, die im Verlagswesen
tätig sind, im Laufe der Zeit verloren haben und wiedergewinnen sollten – die Bedeutung der Form, meine ich. Und genau da, dachte ich, sollte man wieder ansetzen.
Wenige Tage vor dem offiziellen Launch stellten wir fest, dass der Name nicht verwendet werden durfte. Der Name ist heute eine eingetragene Marke, die zudem nicht als Lizenz vergeben wird. Einen Moment lang fragte ich mich, was der bekanntlich schnell brüskierte Schriftsteller davon gehalten hätte, aber im nächsten Moment musste ich mich auf ein dringenderes Problem konzentrieren – wie zum Kuckuck sollte der Verlag heißen, der jeden Tag an den Start gehen sollte. In solchen Fällen greift man auf die eigenen Vorlieben zurück, und für eine beunruhigend lange Zeitspanne drohte es der Name einiger Tennisspieler zu werden, die keine bedeutenden Preise gewonnen hatten, oder einer der vielen vom Eis zertrümmerten Dreimaster, die ein trauriges Ende nahmen. Aber zum Glück sind nicht alle Obsessionen verhängnisvoll, und beim Betrachten einer Postkarte aus dem frühen 20. Jahrhundert, die ich seit einer fernen Reise nach Ungarn mit mir herumtrage, kam mir der Gedanke, dass dieses Bild ein gutes Logo sein könnte – für einen bis dahin nur in Gedanken existierenden Verlag. Es handelte sich um eine Strichzeichnung, die den ersten Doppeldecker darstellte, mit dem die Gebrüder Wright an einem Dezembermorgen im Jahr 1903 für ein Dutzend Sekunden vom Boden abhoben. Nun – derjenige, der von den beiden Brüdern auf der Zeichnung und auch in Wirklichkeit am Steuer saß, war Orville. Bevor er versuchte zu fliegen, hatte er sich mit anderen Dingen beschäftigt, die mir sehr gefielen. Fahrräder, zum Beispiel. Und auch eine Zeitung, denn er hatte einem Drucker bei dessen Geschäftsauflösung ein paar Monotype-Setzmaschinen abgekauft. Orville hatte sogar ein paar Bücher veröffentlicht, bevor er sich anderen Dingen zuwandte. Aber dabei hat er nicht alles hinter sich gelassen. Den Doppeldecker hatte er mit dem Pragmatismus, für den er ziemlich bekannt war, Flyer genannt. Das heißt, ein Ding, das fliegt. Aber, in der Typografie, auch ein Flugblatt.
Vielleicht fanden die Puzzleteile gerade ihren Platz. Oder ich konnte sie so platzieren.
Bis Juni 2023 hat Orville drei Bücher veröffentlicht. Es sind nur wenige, aber ich denke, sie vermitteln einen Eindruck von dem Kurs meines Vorhabens. Das erste, Box Hill, von Adam Mars-Jones, ist einfach eine Geschichte über die Liebe zwischen zwei Männern, die von dem ganzen Nonsens befreit ist, von dem man oft glaubt, dass solche Geschichten eingekleidet werden müssen, damit sie erzählt werden können. Tatsächlich ist es eine Geschichte, die von fast allem befreit ist, außer von den Fakten, aus denen sie sich zusammensetzt und die nicht alle angenehm sind. Es ist wie einer dieser spärlichen Indie-Filme, die mit drei Groschen, einer siebenköpfigen Crew und einem fünfundzwanzigseitigen Drehbuch gedreht wurden, und einer der Gründe, warum mir Adam immer gefallen hat, ist genau das Verhältnis zwischen der Menge der Dinge, die gesagt werden, und dem winzigen Raum, in dem er es geschafft hat, sie zu sagen. Wegen einem der Tricks, die Verlagskataloge oft anwenden, um Interesse zu wecken, liegt Box Hill neben einem Buch, das nicht unterschiedlicher sein könnte. La tempesta è qui (The Storm Is Here), die großartige Reportage, in der Luke Mogelson das Jahr vor der Erstürmung des Kapitols – und die Erstürmung selbst, aus nächster Nähe betrachtet – schildert, ist ein wahrer Koloss. Mit einer vielfältigen Besetzung – die eine Hälfte besteht aus Stars, die andere aus Menschen von der Straße -, mit Drehorten, die über die Hälfte der Vereinigten Staaten verstreut sind, und mit Szenen, die wohl oder übel ein hohes Maß an Spektakel bieten. Aber es ist vor allem ein Beleg dafür, wohin dokumentarisches Schreiben gehen kann, nämlich Fakten, Charaktere, Ideen über die Welt, die wir alle zu kennen glaubten, in einen Roman über das Amerika dieser Jahre zu verwandeln, den bisher noch niemand geschrieben hat. Dann gibt es noch Le forze della terra (Die Kräfte der Erde) von Jo Ann Beard, das vielleicht das einzigartigste Buch der drei ist. Ich möchte nicht viel darüber sagen, nur dass es im Kern eine der großen Geschichten der letzten Jahrzehnte enthält. Sie heißt Il quarto stato della materia (Der vierte Aggregatzustand der Materie) und erzählt eine Episode abscheulicher Gewalt auf eine so außergewöhnliche Art und Weise, dass man glaubt, Jo Anns Beschreibungen seien in Wahrheit der vierte Aggregatzustand der Fiktion, also der Gral, nach dem in den letzten Jahren jeder gesucht hat und den niemand oder fast niemand gefunden zu haben scheint.
Damit wäre ich am Ende angelangt, ich glaube, ich habe schon zu viel geredet. Wie gesagt, mag ich es, Bücher zu machen, aber viel weniger darüber zu reden – das Reden wäre ihre Aufgabe. Und auch hinsichtlich der kommenden Bücher würde ich mich lieber auf die Garantie beschränken, dass es tatsächlich Bücher sein werden – ein Anspruch, der in der gegenwärtigen Lage, in der wir leben müssen, mehr oder weniger wie eine Bittschrift klingt, wenn nicht sogar wie ein Schlachtruf. Aber nun ist es wirklich genug. Wie der andere Wright, Wilbur, sagte, sind die einzigen Tiere, die sprechen, Papageien: und die fliegen nicht so hoch, soweit ich weiß.